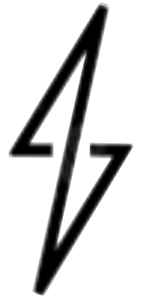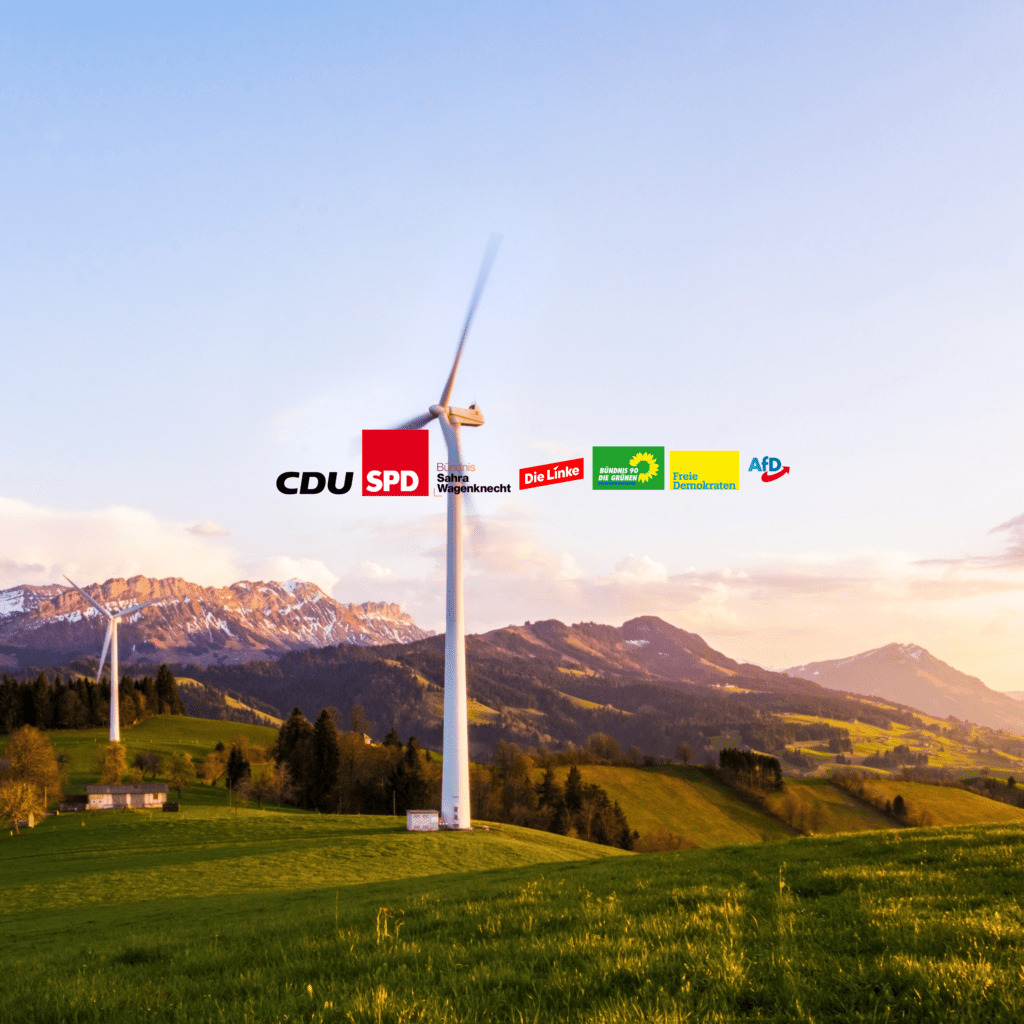Die Transformation des deutschen Energiesystems steht an einem kritischen Wendepunkt. Die politischen Parteien präsentieren in ihren Wahlprogrammen höchst unterschiedliche Visionen für die Zukunft der Energieversorgung und -nutzung im Gebäudesektor.
Von radikaler Ablehnung bis hin zu ambitionierten Zielen spannt sich ein weiter Bogen der energiepolitischen Positionen. Diese Diversität der Ansätze spiegelt die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider. Besonders im Gebäudesektor, der für etwa ein Drittel der deutschen CO₂-Emissionen verantwortlich ist, zeigen sich fundamentale Unterschiede in den Konzepten zur Transformation des Bestands.
Wir haben die Parteiprogramme durchforstet und die Positionen der Parteien im Energiekontext untersucht:
Klimapolitik 2025-2050
Die langfristigen Klimaziele der Parteien zeigen eine bemerkenswerte Spannbreite: Von vollständiger Ablehnung des Pariser Klimaabkommens bis hin zu ambitionierten Zielen wie Klimaneutralität bereits 2040. Diese fundamentalen Unterschiede in der Grundausrichtung prägen maßgeblich alle weiteren energiepolitischen Entscheidungen und Maßnahmen, wobei besonders die zeitliche Komponente der Zielerreichung stark diskutiert wird.
CDU:
- Bekenntnis zu Pariser Klimazielen und Klimaneutralität bis 2045
- Festhalten am Kohlekompromiss, aber: “kein weiteres endgültiges Abschalten von Kohlekraftwerken ohne Ersatz durch neue Gaskraftwerke und KWK-Anlagen” (S. 19)
- Dekarbonisierung im Gebäudebereich über CO₂-Bepreisung mit sozialem Ausgleich
CSU:
Die grundsätzliche Position der CSU ist, dass “Klimaschutz nur mit einer starken Wirtschaft, nur global und gemeinsam mit den Menschen” geht (S. 15). Die Partei kritisiert die “ideologiegetriebene Energiepolitik der Ampel” und warnt vor einer Deindustrialisierung (S. 15). Als konkrete Maßnahme wird die “Abschaffung der EU-Taxonomie” und ein “Umbau des Green Deals hin zu einem Growth-Deal” gefordert (S. 7).
SPD:
- “Klares Bekenntnis zu Klimazielen für Deutschland und EU”
- Unterstützung des European Green Deal für klimaneutrales Europa
- Definition von Klimaneutralität als “Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge” (S. 33)
- Fokus auf sozialverträgliche Umsetzung: Klimaschutz muss “leistbar sein” (S. 33)
Grüne:
- Klimaneutralität 2045 (S. 38)
- Zwischenziel: 80% erneuerbare Energien bis 2030 (S. 41)
- Klimaneutraler Strom bis 2035 (S. 41)
- Kohleausstieg 2030 und Gasausstieg spätestens 2045 (S. 43)
Die Linke:
- Ambitionierteres Ziel: Klimaneutralität bis 2040 (S. 32)
- Kritik an Schwächung des Klimaschutzgesetzes
- Forderung nach Wiedereinführung der Sektorziele (S. 32)
- Konzept der Warmmietenneutralität im Gebäudesektor

BSW:
- Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen bei gleichzeitiger Ablehnung des aktuellen Umsetzungskurses (S. 9)
- Kritik am “Wunschdenken einer schnell erreichbaren völligen Klimaneutralität” (S. 10)
- Fokus auf technologieoffene Innovation statt Verbote (S. 12)
- Unterstützung für CCS/CCU-Technologien
FDP:
- Ersetzung des nationalen Ziels (Klimaneutralität 2045) durch EU-Ziel (Klimaneutralität 2050) (S. 39)
- Fokus auf europäischen Emissionshandel als Leitinstrument
- Befürwortung von Kernfusion und Kernkraft “ohne Subventionen” (S. 17)
- Vollständige Marktintegration erneuerbarer Energien ohne EEG-Subventionen (S. 16)
AfD:
- Grundsätzliche Ablehnung der aktuellen Klimapolitik
- Klimawandel als “komplexes Phänomen” mit “wissenschaftlich ungeklärtem” menschlichen Anteil (S. 77)
- Forderung nach Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen (S. 79)
- Ziel einer “modernen sozialen Marktwirtschaft” ohne klimapolitische Vorgaben (S. 79)
Energieberatung
Die Energieberatung als Schlüsselinstrument der Energiewende wird in den Parteiprogrammen erstaunlich unterschiedlich gewichtet. Von umfassenden Ausbaukonzepten bis hin zu völligem Fehlen jeglicher Erwähnung spannt sich ein weiter Bogen, der die verschiedenen Grundhaltungen zur staatlichen Lenkung der Energiewende widerspiegelt.
CDU/CSU:
- Keine expliziten Aussagen zur Energieberatung im Wahlprogramm
SPD:
- Erwähnung im Kontext des “Strom-Spar-Checks” für einkommensschwache Haushalte
- Plan zum deutschlandweiten Ausbau und zur Verstetigung (S. 34)
Grüne:
- Massiver Ausbau der Energieberatung geplant
- Fokus auf Qualitätssicherung und Unabhängigkeit (S. 71)
- Beratung als wichtiger Baustein für klimaneutrales und bezahlbares Heizen
Die Linke:
- “Flächendeckende Beratungsangebote mit Sanierungsbeauftragten für alle sanierungsbedürftigen Häuser” (S. 34)
- Stärkung der kommunalen Wärmeplanung mit Bürgerbeteiligung
BSW:
- Keine direkten Aussagen zur Energieberatung
FDP:
- Keine direkten Aussagen zur Energieberatung
AfD:
- Keine direkten Aussagen zur Energieberatung
- Indirekte Ablehnung durch Kritik an “kostentreibenden Vorgaben” (S. 36)
Energetische Sanierung
Die energetische Sanierung des Gebäudebestands stellt eine zentrale Säule der Energiewende dar. Die Konzepte der Parteien unterscheiden sich fundamental in ihren Ansätzen – von massiven staatlichen Förderprogrammen bis hin zur kompletten Ablehnung regulatorischer Eingriffe. Besonders die soziale Komponente und die Frage der Finanzierung werden kontrovers diskutiert.
CDU:
- “Effiziente energetische Sanierung des Immobilienbestands” als Ziel
- Fokus auf steuerliche Anreize über Erbschaft- und Schenkungsteuer (S. 71)
- Beibehaltung des Energieeffizienzstandards EH55 für Neubauten mit Förderung
CSU:
Im Wahlprogramm wird die energetische Sanierung hauptsächlich aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet. Konkrete technische Anforderungen oder verpflichtende Standards für Sanierungen werden nicht definiert. Die CSU setzt stattdessen auf einen freiwilligen, anreizbasierten Ansatz zur Modernisierung des Gebäudebestands (S. 15). Das Programm spricht sich gegen verbindliche Vorgaben aus, wie die Ablehnung des Gebäudeenergiegesetzes zeigt (S. 15).
SPD:
- Fokus auf gemeinschaftliche Lösungen und Quartiersansätze
- Betonung klimaneutraler Wärmenetze als effizientere Alternative zu Einzellösungen (S. 33)
- Kommunale Wärmeplanung als “Meilenstein” (S. 33)
- “Heiz-Mietmodelle” und “soziales Wärmepumpen-Leasing” für ärmere Haushalte (S. 34)
Grüne:
- Sozial gestaffelte Förderung bis 70% für fossilfreie Heizungen (S. 71)
- Besondere Förderung kleiner Sanierungsmaßnahmen wie Kellerdeckendämmung
- Präferenz für Umbau statt Abriss
- Kombination von Sanierung mit Aufstockung wo möglich (S. 71)
- Warmmietenneutrale Umlage von Sanierungskosten (S. 69)
Die Linke:
- “Investitionsoffensive” mit 25 Milliarden Euro jährlich (S. 34)
- Einkommensabhängige Förderung:
- Niedrige Einkommen: bis zu 100% Förderung
- Mittlere Einkommen: gestaffelt (bei 30.000€: 82%, bei 60.000€: 42%)
- Ab 250.000€: keine Förderung
- Verpflichtung von Immobilienkonzernen zu Sanierungsplänen bis 2026
- Abriss nur bei nicht zu rettender Bausubstanz oder deutlicher Wohnraumvermehrung

BSW:
- Keine spezifischen Aussagen zu Sanierungsmaßnahmen
- Kritik an “planlosem Aktivismus” (S. 3)
- Ablehnung von Zwangssanierungen
FDP:
- Lockerung der “starren Kappungsgrenzen bei energetischen Sanierungen” (S. 43)
- Fokus auf Modernisierung zur Nebenkostensenkung
- Verbesserung steuerlicher Abschreibungen im Wohnungsbau
- Fortführung der “Sonderabschreibung des Wachstumschancengesetzes” (S. 42-43)
AfD:
- Ablehnung von “ideologiegetriebenen Kosten” und Sanierungspflichten (S. 36)
- Grundsätzliche Opposition gegen staatliche Eingriffe
- Ablehnung energetischer Sanierungspflichten
Förderung & Steuervorteile für energetische Sanierung
Die Ansätze bei der Förderlandschaft für energetische Maßnahmen reichen von umfassenden, sozial gestaffelten Fördersystemen bis hin zur kompletten Ablehnung staatlicher Unterstützung. Besonders die Verknüpfung von Förderung und sozialer Gerechtigkeit steht bei vielen Parteien im Fokus.
CDU:
- Kosten für energetische Sanierungen von Erbschaft- und Schenkungsteuer abzugsfähig (S. 71)
- EH55-Standard für Neubauten soll wieder förderfähig werden
- Technologieoffene Förderung emissionsarmer Wärmelösungen
- Klimabonus zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen
CSU:
- Entwicklung eines Energiebonus aus dem bestehenden Handwerkerbonus für bessere steuerliche Berücksichtigung energetischer Sanierungen (S. 15)
- Innovative Möglichkeit zur Absetzbarkeit von energetischen Sanierungskosten von der Erbschaftsteuer (S. 15)
- Sonderabschreibungen für Sanierungen im Mietwohnungsbau (S. 19)
- Wiedereinführung der Förderfähigkeit des Energieeffizienzstandards EH55 für Neubauten (S. 19)
- Technologieoffene Förderung verschiedener Wärmelösungen (S. 15)
SPD:
- Staatliche Unterstützung fokussiert auf einkommensschwache Haushalte
- “Heiz-Mietmodelle” als soziales Wärmepumpen-Leasing (S. 34)
- Fokus auf gemeinschaftliche, kostengünstige Lösungen
- Klimageld als sozialer Ausgleich ab 2027
Grüne:
- Sozial gestaffelte Förderung bis 70% für fossilfreie Heizungen (S. 71)
- Besondere Förderung kleiner, effektiver Maßnahmen
- Vorschüsse für Sanierungen möglich
- Förderung steigt mit Energieeinsparung (S. 71)
- Wärme-Contracting zur Vermeidung hoher Startinvestitionen
Die Linke:
- 25 Milliarden Euro jährliche Investitionsoffensive (S. 34)
- Staffelung nach Einkommen:
- Bis 100% für niedrige Einkommen
- 82% bei 30.000€ Jahreseinkommen
- 42% bei 60.000€ Jahreseinkommen
- Keine Förderung ab 250.000€
- Verpflichtende Fördernutzung für Vermieter
BSW:
- Grundsätzliche Kritik an aktueller Förderpraxis
- Ablehnung “planlosen Aktivismus” (S. 3)
- Kritik am “Verbrennen von Steuergeldern” im Klimabereich
- Technologieoffene Förderung ohne Diskriminierung einzelner Technologien
FDP:
- Verbesserte steuerliche Abschreibungen im Wohnungsbau
- Fortführung Sonderabschreibung Wachstumschancengesetz (S. 42-43)
- Fokus auf marktwirtschaftliche Anreize statt direkter Förderung
- Ablehnung technologiespezifischer Förderung
AfD:
- Grundsätzliche Ablehnung staatlicher Förderprogramme
- Kritik an “ideologiegetriebenen Kosten” (S. 36)
- Fokus auf Marktmechanismen ohne staatliche Eingriffe
- Ablehnung klimapolitisch motivierter Förderung
Gebäudeenergiegesetz & Sanierungspflichten
Das Gebäudeenergiegesetz stellt einen der kontroversesten Punkte in der energiepolitischen Debatte dar. Die Positionen reichen von strikter Ablehnung jeglicher Vorgaben bis hin zur Befürwortung klarer gesetzlicher Regelungen und Pflichten. Besonders die Frage der Technologieoffenheit wird intensiv diskutiert.
CDU:
- Komplette Abschaffung des Heizungsgesetzes gefordert (S. 20)
- Ablehnung des “bürokratischen Reinregierens in den Heizungskeller”
- Technologieoffene Förderung statt Verbote
- Explizite Einbeziehung von Holz als Heizmaterial
CSU:
-
Die CSU positioniert sich eindeutig für eine Abschaffung des “Ampel-Heizungsgesetzes” und lehnt das “Hineinregieren in den Heizungskeller” ab (S. 15). Verpflichtende Sanierungsstandards oder -pflichten werden im Programm nicht erwähnt.
SPD:
- Keine konkreten Aussagen zum GEG
- Fokus auf kommunale Wärmeplanung statt individueller Verpflichtungen
- Betonung von Quartiersansätzen
- Klimaneutralität als “Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge”
Grüne:
- GEG als wichtiger Rahmen für Wärmewende
- Planungssicherheit bis 2045 für alle Beteiligten (S. 71)
- Klare Vorgaben für Umstieg auf fossilfreie Heizungen
- Warmmietenneutrale Umlage von Sanierungskosten angestrebt (S. 69)
Die Linke:
- Kritik am Heizungsgesetz als “gesellschaftsspaltend” (S. 34)
- Sanierungspflichten für Immobilienkonzerne bis 2026
- Abrisseinschränkungen bei Bestandsgebäuden
- Warmmietenneutralität als zentrales Konzept

BSW:
- Forderung nach sofortiger Abschaffung des GEG (S. 9)
- Kritik an “undurchdachten” Vorgaben
- Ablehnung von Zwangssanierungen
- Kritik an hohen Umbaukosten für Wärmepumpen
FDP:
- Forderung nach vollständigem Auslaufen des Heizungsgesetzes (S. 44)
- “Gebäudetyp E” als “Blaupause für Entrümpelung des Baurechts” (S. 43)
- Technologieoffene Lösungen statt Vorgaben
- Ablehnung von Zwangsanschlüssen an Fernwärmenetze
AfD:
- “Aufhebung des Verbots von Gas- und Ölheizungen” (S. 13)
- Forderung nach Abschaffung des GEG
- Ablehnung “strangulierender Bürokratie”
- Grundsätzliche Opposition gegen Sanierungspflichten
Erneuerbare Energien & Heiztechnik
Die technologische Ausrichtung der Wärmewende ist ein weiterer kontrovers diskutierter Aspekt. Während einige Parteien auf spezifische Technologien setzen, fordern andere einen technologieoffenen Ansatz. Besonders die Rolle von Wasserstoff, Biomasse und Kernenergie wird kontrovers diskutiert, ebenso wie die Gewichtung zwischen zentralen und dezentralen Lösungen.
CDU:
- “Zielgerichteter weiterer Ausbau der Erneuerbaren Energien” (S. 19)
- Breites Technologiespektrum:
- Wind (On- und Offshore)
- Solar
- Geothermie
- Wasserkraft
- Bioenergie
- Holz als nachwachsender Rohstoff
- Kraft-Wärme-Kopplung
- Pro Kernenergie:
- Option auf Weiterbetrieb der letzten KKW
- Forschung zu Generation 4/5
- Small Modular Reactors
- Fusionskraftwerke
CSU:
Bei den Heizungstechnologien setzt die Partei auf einen technologieoffenen Ansatz mit Förderung aller emissionsarmen Wärmelösungen, wobei explizit auch das Heizen mit Holz einbezogen wird (S. 15). Geplant ist ein “sinnvoller, kosteneffizienter und beschleunigter Ausbau aller Erneuerbaren Energien sowie von Netzen und Speichern” (S. 15). Die Hemmnisse bei Großbatteriespeichern sollen abgebaut werden (S. 15).
SPD:
- Wärmepumpen und Wärmenetze als Schwerpunkt
- Wind und Photovoltaik als “günstigste Stromproduktion” (S. 34)
- Bundesweite Preisaufsicht für Fernwärme geplant (S. 34)
- Fokus auf gemeinschaftliche Wärmelösungen
Grüne:
- Klare Präferenz für Wärmepumpen
- Ablehnung von Wasserstoff für Wärmeversorgung (S. 72)
- Kritische Haltung zur Holzverbrennung
- Ausbau erneuerbarer Wärmenetze (S. 71-72)
Die Linke:
- Klare Position gegen E-Fuels im Gebäudebereich
- Wasserstoff nur für “unverzichtbare” industrielle Produktion (S. 33)
- Solarpflicht für Neubauten und sanierte Dächer
- Fokus auf kommunale Wärmeplanung
BSW:
- Technologieoffener Ansatz
- Erhalt der Gasnetze ohne Rückbau (S. 10)
- Ausbau Fernwärme/Geothermie (Ziel: 100 TWh bis 2030) (S. 12)
- Förderung von KWK-Anlagen über 2025 hinaus
FDP:
- Technologieoffene Lösungen bei Wärmewende (S. 44)
- Pro Holzheizungen, weniger Auflagen für Kamine
- Gegen Zwangsanschluss an Fernwärmenetze (S. 44)
- Befürwortung Kernfusion und Kernkraft “ohne Subventionen”
AfD:
- Wiedereinstieg in Kernenergie
- Verlängerung Kohlekraftwerkslaufzeiten (S. 13)
- Ablehnung Windkraft- und PV-Ausbau als “Naturzerstörung” (S. 39)
- Kritik an Erneuerbaren als nicht marktfähig (S. 40)
CO₂ & Energiekosten
Die CO₂-Bepreisung und die Gestaltung der Energiesteuern bilden einen zentralen Baustein der klimapolitischen Instrumente. Die Konzepte der Parteien unterscheiden sich grundlegend – von der kompletten Ablehnung jeglicher CO₂-Bepreisung bis hin zur Nutzung als marktwirtschaftliches Leitinstrument. Besonders die soziale Ausgestaltung und die Verwendung der Einnahmen stehen im Fokus der Debatte.
CDU:
- Emissionshandel als “Leitinstrument” (S. 22)
- Schrittweise Einbeziehung aller Sektoren in EU-ETS
- Senkung der Stromsteuer für alle
- Reduzierung der Netzentgelte
- Klimabonus zur Entlastung
- CO₂-Einnahmen primär für Senkung von Stromsteuer/Netzentgelten
- “Höhere CO₂-Abgaben müssen zu höheren Entlastungen führen” (S. 22)
CSU:
- Die CSU plant eine vollständige Rückgabe der CO₂-Bepreisungseinnahmen an Bürger und Unternehmen durch zwei konkrete Maßnahmen: Die Reduzierung der Stromsteuer auf das europäische Minimum sowie eine Halbierung der Netzentgelte (S. 15). Zusätzlich sollen die “übermäßigen Belastungen durch CO₂-Preis” reduziert werden (S. 7).
SPD:
- Festhalten am CO₂-Preis von “55 Euro/Tonne in 2025 und max. 65 Euro in 2026”
- Ab 2027 europäische Regelung
- Soziale Härten durch “Klimageld” vermeiden (S. 33-34)
- Fokus auf sozialverträgliche Ausgestaltung
Grüne:
- Senkung Stromsteuer auf EU-Minimum (S. 42)
- Übernahme überregionaler Netzentgelte durch Deutschlandfonds
- Sozial gestaffeltes Klimageld als CO₂-Preis-Kompensation (S. 40)
- Reform der Fernwärmepreisaufsicht (S. 71)
Die Linke:
- Ablehnung von CO₂-Preisen im Wärmebereich
- Begründung: “Mieter können Heizungen nicht wechseln” (S. 34)
- Klimageld: 320 Euro jährlich pro Person als Direktzahlung (S. 7)
- Stromsteuer auf EU-Mindeststeuersatz
- Strompreissenkung um bis zu 9 Cent/kWh angestrebt (S. 32)
BSW:
- Grundsätzliche Ablehnung der CO₂-Bepreisung (S. 10)
- Kritik: CO₂-Preis “macht alles teurer ohne Alternativen” (S. 10)
- Europäischer Emissionshandel: Globalisierung oder Abschaffung (S. 11)
FDP:
- Stromsteuer zunächst auf EU-Mindestmaß, dann Abschaffung
- EU-Mindestsätze für Energiesteuer “sukzessive bis null” reduzieren
- CO₂-Preis soll Strom- und Energiesteuer “perspektivisch ersetzen” (S. 16)
- “Klimadividende” als sozialer Ausgleich (S. 39)
AfD:
- “Abschaffung der CO₂-Abgabe” (S. 13, S. 57)
- “Reduzierung der Energiesteuer”
- Senkung der Stromsteuer auf Minimum (S. 13)
- “Verhinderung höherer Netzentgelte durch Windenergie-Ausbaustopp” (S. 13)
Fazit: Die entscheidenden Punkte
Die detaillierte Analyse der Parteiprogramme offenbart deutliche Lagerbildungen, aber auch unerwartete Gemeinsamkeiten in der energiepolitischen Ausrichtung.
Im linken Spektrum zeigt sich eine klare Übereinstimmung zwischen SPD, Grünen und Linken: Sie setzen auf eine starke staatliche Steuerung der Wärmewende und machen die soziale Frage zum Kernthema. Alle drei Parteien präferieren Wärmepumpen und Wärmenetze, während sie Wasserstoff im Gebäudesektor einhellig ablehnen. Die soziale Staffelung von Förderungen zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Programme.
Das konservativ-liberale Lager, bestehend aus CDU/CSU, FDP und BSW, eint vor allem der Ruf nach Technologieoffenheit. Sie lehnen das aktuelle Gebäudeenergiegesetz ab und setzen stattdessen auf marktwirtschaftliche Lösungen. Der Erhalt der Gasinfrastruktur ist ihnen wichtig, wobei sie die Transformation des Energiesystems stärker dem Markt überlassen wollen als das linke Lager.
Bemerkenswert sind die parteiübergreifenden Konsenspunkte: Mit Ausnahme der AfD erkennen alle Parteien die Notwendigkeit von Förderungen an. Auch bei der Senkung der Stromsteuer und der Bedeutung von Kraft-Wärme-Kopplung herrscht weitgehende Einigkeit. Die grundsätzliche Anerkennung der Klimaziele eint ebenfalls alle Parteien – außer der AfD.
Die AfD nimmt mit ihrer kompletten Ablehnung des menschengemachten Klimawandels eine Sonderrolle ein. Ihre Positionen stehen in fundamentalem Gegensatz zu allen anderen Parteien und basieren auf völlig anderen Grundannahmen.
Für die Zukunft der Energiewende lassen sich vier zentrale Erkenntnisse festhalten:
- Die Wärmewende wird kommen – die Frage ist nicht ob, sondern wie.
- Der Weg dorthin wird zwischen staatlicher Lenkung und Marktmechanismen ausgehandelt werden müssen.
- Der Konflikt zwischen Technologieoffenheit und klaren technologischen Präferenzen bleibt bestehen.
- Die soziale Abfederung der Transformation wird von allen relevanten Parteien als notwendig erachtet.
Immobilienbesitzer müssen sich darauf einstellen: Die Grundrichtung der Wärmewende steht fest, aber der konkrete Umsetzungsweg wird maßgeblich von künftigen politischen Mehrheitsverhältnissen bestimmt werden.
Quellen:
Wahlprogramm Bundestagswahl CDU
Wahlprogramm Bundestagswahl CSU
Wahlprogramm Bundestagswahl SPD
Wahlprogramm Bundestagswahl Grüne
Wahlprogramm Bundestagswahl Die Linke
Wahlprogramm Bundestagswahl BSW
Wahlprogramm Bundestagswahl FDP
Wahlprogramm Bundestagswahl AfD